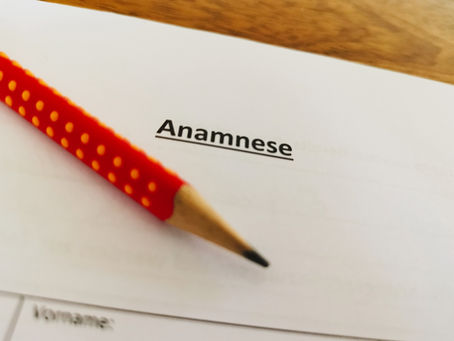- Sonja Speck
- vor 5 Tagen
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 3 Tagen

Über Wintermüdigkeit klagen gerade sehr viele, und ich höre das auch aktuell bei vielen meiner Patientinnen und Patienten. Das Muster ist oft ähnlich: morgens schwer in Gang kommen, tagsüber weniger Energie, nachmittags ein Tief, abends dann plötzlich wieder wacher, dazu mehr Infektanfälligkeit oder das Gefühl, dass Regeneration länger dauert.
Wintermüdigkeit hat selten einen einzelnen Auslöser. Häufig kommen mehrere Winterfaktoren gleichzeitig zusammen.
Weniger Tageslicht am Morgen
Tageslicht ist ein zentrales Signal für den Tag Nacht Rhythmus. Wenn dieses Signal schwächer ist, verschiebt sich der innere Takt leicht nach hinten. Das kann sich morgens wie ein Start mit angezogener Bremse anfühlen und abends als spätere Müdigkeit.
Weniger Bewegung im Alltag
Im Winter fallen Wege zu Fuß und spontane Bewegung häufig weg. Für den Körper ist Bewegung nicht nur Fitness, sondern ein Signal: Energie wird gebraucht. Wenn dieses Signal geringer ist, reagiert der Stoffwechsel oft mit weniger Antrieb und weniger Stabilität über den Tag.
Mehr Immunlast und mehr Entzündungssignale
Kälte, Infektzeit und gereizte Schleimhäute erhöhen bei vielen die Belastung. Das Immunsystem braucht Energie. Wenn es dauerhaft mitläuft, steht weniger Energie für Leistung und Regeneration zur Verfügung.
Ernährungsverschiebung
Im Winter wird oft dichter gegessen, weniger frisch, manchmal weniger proteinbetont, häufiger snacking. Das kann Blutzucker und Energie über den Tag instabiler machen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Nährstoffdichte häufig eher, als dass er sinkt.
Funktionell lohnt sich dann der Blick auf ein System, das sehr sensibel auf Umwelt und Lebensstil reagiert: die Mitochondrien.
Mitochondrien stellen einen Großteil der zellulären Energie bereit, koordinieren Stoffwechselwege und sind eng mit oxidativem Stress und Entzündungssignalen verknüpft. Wenn diese Balance kippt, kann sich das als reduzierte Belastbarkeit bemerkbar machen.
Was Mitochondrien konkret tun
Mitochondrien wandeln Nährstoffe und Sauerstoff in Energie um, vor allem über den Citratzyklus und die Atmungskette. Dafür brauchen sie nicht nur Kalorien, sondern auch eine Reihe an Mikronährstoffen und Cofaktoren, damit die beteiligten Enzyme zuverlässig arbeiten.
Was Mitochondrien brauchen
1. Mikronährstoffe als Cofaktoren der Energieproduktion
Viele Schritte der Energiegewinnung laufen nur stabil, wenn bestimmte Vitamine und Mineralstoffe als Cofaktoren vorhanden sind.
B Vitamine
Mehrere B Vitamine sind zentrale Coenzyme im Energiestoffwechsel. Bei unzureichender Versorgung kann die mitochondriale Verwertung von Aminosäuren, Glukose und Fettsäuren beeinträchtigt sein. Zusätzlich ist gut beschrieben, dass spezifische aktive Formen von B Vitaminen und verwandten Cofaktoren in die Mitochondrien transportiert werden müssen, damit sie dort wirken können.
Magnesium
Magnesium ist funktionell eng mit ATP verknüpft und unterstützt Prozesse der mitochondrialen ATP Synthese.
Eisen
Eisen ist für die Zellenergie relevant, weil Eisen Cofaktoren in der Atmungskette und für Eisen Schwefel Cluster benötigt werden. Das betrifft die Elektronenübertragung und damit die Effizienz der Energiegewinnung.
Coenzym Q10
Coenzym Q10 ist als Elektronenträger in der Atmungskette zentral und damit direkt mit ATP Produktion verbunden.
Carnitin
Carnitin ist wichtig für den Transport langkettiger Fettsäuren in die Mitochondrien, damit diese dort über Beta Oxidation genutzt werden können.
Ein praktischer funktioneller Gedanke dazu: Ein hoher Energiebedarf im Alltag steigt schnell, aber die Versorgung mit Cofaktoren steigt nicht automatisch mit. Darum ist Nährstoffdichte ein Grundpfeiler, wenn das Thema Energie im Vordergrund steht.
2. Ausreichend Baustoffe für Struktur und Reparatur
Mitochondrien sind nicht nur Enzymmaschinen, sie haben Membranen, Proteine und ein sensibles Reparatursystem. Dafür braucht der Körper vor allem:
Protein
Aminosäuren sind Baustoffe für Enzyme, Transporter und Strukturproteine. Eine gleichmäßige Proteinzufuhr kann helfen, Reparatur- und Aufbauprozesse zu unterstützen, besonders in Phasen höherer Belastung.
Fette in guter Qualität
Mitochondriale Membranen müssen stabil und funktionell bleiben. Fette liefern nicht nur Energie, sie sind auch Bausteine für Zellmembranen und damit für die Funktion der Mitochondrien relevant. Gesättigte Fettsäuren sind wichtig für die Stabilität der Membranen. Sie kommen vor allem in Butter, Ghee, Käse, Sahne, Eiern, Fleisch sowie in Kokos und Kakao vor. Ungesättigte Fettsäuren geben der Membranstruktur ihre Flexibilität; einfach ungesättigte finden sich zum Beispiel in Olivenöl, Avocado und Nüssen, mehrfach ungesättigte unter anderem in Walnüssen, Leinsamen, Chiasamen sowie in fettem Seefisch. Beide sind gleichermaßen wichtig für den Aufbau einer gesunden und gut funktionierenden Zellmembran.
3. Eine niedrige Entzündungs- und Stresslast im System
Mitochondrien sind zugleich Quelle und Ziel von oxidativem Stress und Entzündungssignalen. Chronisch erhöhte Entzündungsaktivität und anhaltender oxidativer Druck können mitochondriale Prozesse stören und sich als reduzierte Energie bemerkbar machen.
Funktionell sind hier drei Alltagsfaktoren besonders relevant:
Blutzuckerstabilität
Starke Schwankungen durch sehr zuckerreiche, stark verarbeitete Mahlzeiten können Entzündungs- und Stresssignale erhöhen und die Energie über den Tag instabil machen.
Darmmilieu und Barriere
Ein gereiztes Darmmilieu kann systemische Entzündungssignale fördern. Ballaststoffe, Polyphenole und regelmäßige Mahlzeitenstruktur sind hier häufig hilfreiche Basismaßnahmen.
Schlaf und Rhythmus
Schlaf ist eine zentrale Regenerationsphase für Stoffwechsel und Redoxbalance. Wenn Schlafqualität im Winter sinkt, kann das direkt auf Energie und Belastbarkeit durchschlagen.
4. Regelmäßige Nachfrage nach Energie
Mitochondrien passen sich an Nachfrage an. Bewegungsreize und Muskelarbeit sind starke Signale für mitochondriale Kapazität und Effizienz. In der Praxis zählt weniger die Intensität, sondern die Regelmäßigkeit über die Woche.
Wie du das im Alltag umsetzt
Wenn du mitochondriale Energie funktionell stärken willst, sind diese Bausteine besonders zuverlässig:
Nährstoffdichte Mahlzeiten mit klarer Proteinbasis
Regelmäßige Quellen für B Vitamine und Magnesium aus Lebensmitteln, je nach Ernährungskonzept
Eisenstatus und Eisenaufnahme im Blick, besonders bei starker Menstruation, sehr einseitiger Ernährung oder Leistungsabfall
Hochwertige Fettquellen und ausreichend Omega 3 reiche Lebensmittel
Ballaststoffe und polyphenolreiche Pflanzenvielfalt zur Unterstützung des Darmmilieus
Weniger stark verarbeitete Produkte, die Entzündungssignale und Blutzuckerschwankungen fördern können
Schlafrhythmus und Morgenlicht als verlässliches Timing Signal
Regelmäßige Bewegung als Nachfrage Signal für Energie
Fazit:
Gerade im Winter braucht unser Körper mehr Mikronährstoff-Power, mehr Rhythmus und mehr Schlafqualität – damit die Mitochondrien wieder sauber Energie bauen können.
Wenn du das Thema individuell vertiefen möchtest, kann man in der Praxis strukturiert prüfen, welche Faktoren bei dir im Vordergrund stehen, zum Beispiel Nährstoffversorgung, Schlafrhythmus, Darmfaktoren, Entzündungszeichen und Belastungssteuerung.
Wenn du mehr Informationen zu funktionalmedizinische Themen lesen möchtest, die wissenschaftlich fundiert sind und sich direkt in den Alltag übersetzen lassen, dann ist mein Newsletter genau für dich. Hier kannst du dich für den Newsletter eintragen.
In meinem Empfehlungsnewsletter erhältst du strukturierte, evidenzbasierte Empfehlungen zu Mikronährstoffen und Cofaktoren, die in der Funktionellen Medizin häufig eine Rolle spielen, unter anderem im Kontext von Mitochondrien, Schilddrüse, Energie, Stressachsen und Darm, jeweils mit klarer Einordnung und Dosierungsrahmen zur Orientierung.