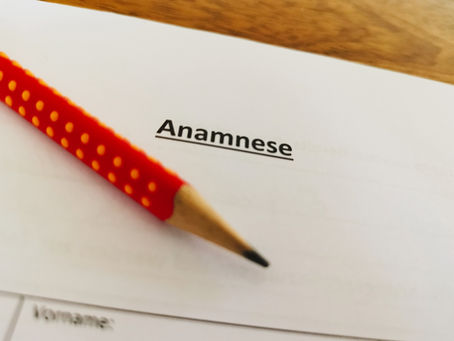- Sonja Speck
- 29. Nov. 2025
- 11 Min. Lesezeit

Jod gehört zu den Nährstoffen, über die im Alltag wenig gesprochen wird, obwohl jede Zelle im Körper davon abhängig ist. Es beeinflusst unseren Energiehaushalt, den Stoffwechsel, Wachstum und Regeneration, die Regulation von Hormonen, die Entwicklung des Nervensystems, das Immunsystem, Fruchtbarkeit und die Entwicklung von Kindern. Wenn Jod fehlt, zeigt sich das oft nicht nur an der Schilddrüse, sondern in vielen unspezifischen Beschwerden wie Müdigkeit, Kälteempfindlichkeit, Haarausfall, trockener Haut, Konzentrationsproblemen, Stimmungsschwankungen, Zyklusbeschwerden oder unerfülltem Kinderwunsch.
Gleichzeitig kursieren sehr widersprüchliche Botschaften. Deutschland gilt nach aktuellen Auswertungen wieder als Jodmangelgebiet, weil ein relevanter Teil von Kindern und Erwachsenen die empfohlene Zufuhr nicht erreicht. Fisch, Meeresfrüchte und Algen stehen selten regelmäßig auf dem Speiseplan, viele Menschen verlassen sich fast ausschließlich auf jodiertes Speisesalz. Gleichzeitig wird vor Jod gewarnt, vor allem bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Das verunsichert verständlicherweise.
In diesem Beitrag geht es darum, Jod einmal in Ruhe und ganzheitlich einzuordnen. Was ist Jod. In welchen Lebensmitteln kommt es vor. Welche Aufgaben erfüllt es im Körper. Wie können Mangel und Überforderung aussehen. Welche Rolle spielen die Natriumiodid-Symporter als Jodtransporter.
Was ist Jod
Jod ist ein essenzielles Spurenelement. Essenziell bedeutet, dass der Körper es nicht selbst herstellen kann und vollständig auf eine regelmäßige Zufuhr über Nahrung oder Nahrungsergänzung angewiesen ist. Spurenelement bedeutet, dass nur sehr kleine Mengen benötigt werden, diese aber eine große Wirkung haben.
Ein erwachsener Körper enthält insgesamt nur wenige Dutzend Milligramm Jod. Ein Teil zirkuliert im Blut, ein großer Teil wird in der Schilddrüse gespeichert, kleinere Mengen in anderen Geweben. Diese kleine Gesamtmenge muss reichen, um alle Jod-abhängigen Prozesse dauerhaft zu versorgen.
Die offiziellen Zufuhrempfehlungen sind in erster Linie so gewählt, dass schwere Mangelfolgen wie ausgeprägte Kropfbildung oder deutliche Entwicklungsstörungen sicher verhindert werden. Sie sagen noch nichts darüber aus, ob sich jemand bei dieser Mindestzufuhr wirklich optimal versorgt und vital fühlt.
In welchen Lebensmitteln steckt Jod
Jod ist vor allem ein Mineralstoff aus dem Meer. Entsprechend sind Lebensmittel aus dem Meer unsere wichtigsten natürlichen Quellen.
Zu den reichhaltigen Quellen gehören Meeresfische wie Seelachs, Kabeljau, Schellfisch oder Scholle und Meeresfrüchte. Schon eine normale Portion kann einen großen Teil der empfohlenen Tageszufuhr abdecken.
Algen wie Nori, Wakame, Kelp und andere Seetange sind besonders jodreich. Kleinste Mengen getrockneter Algen können ausreichen, um den Tagesbedarf zu decken, teilweise sogar deutlich zu überschreiten. Hier braucht es Dosierungsgefühl und gute Information über den tatsächlichen Jodgehalt.
Eier und Milchprodukte enthalten je nach Fütterung der Tiere ebenfalls Jod. Über jodiertes Mineralfutter gelangt etwas Jod in Milch, Joghurt, Käse und Eier. Diese Lebensmittel können die Grundversorgung unterstützen, reichen allein aber selten aus, wenn ansonsten wenig Jod gegessen wird.
Einige Gemüsesorten, Nüsse und Hülsenfrüchte enthalten ebenfalls Jod, allerdings in deutlich geringeren Mengen als Meereslebensmittel. Wie viel tatsächlich enthalten ist, hängt stark vom Jodgehalt des Bodens ab.
Damit du ein Gefühl für die Größenordnungen bekommst, hier beispielhafte Jodgehalte pro 100 g (gerundete Durchschnittswerte, können je nach Herkunft und Analyse schwanken):
Algen und Seetang insgesamt: bis etwa 10 000 µg
Wakame (getrocknet): um 5 000 µg
Nori (getrocknet): etwa 2 000–5 000 µg
Schellfisch: etwa 150 µg
Seelachs: etwa 260 µg
Scholle: etwa 190 µg
Kabeljau: etwa 120 µg
Eier: etwa 10–20 µg pro 100 g (pro Ei je nach Größe und Fütterung)
Milch: etwa 11 µg pro 100 ml
Sahne: etwa 6–9 µg pro 100 g
Quark: etwa 6–9 µg pro 100 g
Joghurt: etwa 6–9 µg pro 100 g
Hartkäse: etwa 20–40 µg pro 100 g
Cashewkerne: etwa 10 µg
Brokkoli: etwa 14 µg
Spinat: etwa 11 µg
Grünkohl: etwa 10 µg
Fenchel: etwa 5 µg
Erbsen: etwa 4 µg
Walnüsse: etwa 3 µg
Erdnüsse: etwa 14 µg
Man sieht daran auch, warum Meereslebensmittel eine so besondere Rolle spielen und warum es schwer ist, allein über Gemüse, Nüsse und Getreide genug Jod aufzunehmen, wenn Fisch und Algen komplett fehlen.
Wie viel Jod steckt in Jodsalz
Für viele ist jodiertes Speisesalz die wichtigste Jodquelle. In Deutschland ist genau geregelt, wie viel Jod zugesetzt werden darf. Der Jodgehalt liegt gesetzlich zwischen 15 und 25 Milligramm Jod pro Kilogramm Speisesalz.
Um das greifbar zu machen:
1 kg Jodsalz mit 15–25 mg Jod enthält 15–25 µg Jod pro Gramm Salz.1 g Jodsalz liefert also ungefähr 15–25 µg Jod, im Mittel etwa 20 µg.
5 g Jodsalz (etwa ein gestrichener bis gehäufter Teelöffel) enthalten dann ungefähr 75–125 µg Jod, im Mittel rund 100 µg.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen maximal etwa 6 g Speisesalz pro Tag. Real liegt die durchschnittliche Aufnahme aber höher, bei etwa 8,4 g Salz täglich bei Frauen und rund 10 g bei Männern.
Das heißt: Selbst wenn jemand ausschließlich Jodsalz verwenden würde, hängt die tatsächliche Jodzufuhr stark davon ab, wie viel Salz insgesamt gegessen wird, wie hoch der Jodgehalt in genau diesem Salz ist und wie viel davon beim Kochen oder durch ungünstige Lagerung verloren geht. Untersuchungen zeigen, dass durch Licht, Feuchtigkeit, Temperatur und lange Lagerung ein Teil des Jods im Salz mit der Zeit abgebaut werden kann.
Dazu kommt, dass wir aus anderen Gründen nicht immer mehr Salz essen sollten. Deshalb ist Jodsalz aus meiner Sicht eher eine zusätzliche Stütze, aber keine wirklich hochwertige Hauptlösung für die Jodversorgung.
Funktionen und Wirkungen von Jod im Körper
Jod wird oft nur mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht, seine Wirkung geht aber deutlich weiter. Es gibt mehrere große Bereiche, in denen Jod eine zentrale Rolle spielt.
Schilddrüse und Stoffwechsel
Die Schilddrüse speichert einen Großteil des Jods und benötigt es, um die Schilddrüsenhormone T4 (Thyroxin) und T3 zu bilden. Diese Hormone sind eine Art innerer Taktgeber für den gesamten Stoffwechsel. Sie steuern unter anderem Grundumsatz, Temperaturregulation, Herzfrequenz, Verdauungstempo, Muskelkraft und Regeneration.
Fällt die Jodzufuhr länger zu niedrig aus, kann die Schilddrüse wachsen, um mehr Jod aus dem Blut zu „fangen“. Es kann zu Kropf, Knoten oder Funktionsstörungen kommen. Auch ohne dramatische Befunde kann ein zäher, langsamer Stoffwechsel entstehen, der sich in Müdigkeit, Antriebslosigkeit und einer Neigung zu Gewichtszunahme zeigt.
Weitere Drüsen und Gewebe
Der Körper nutzt Jod nicht nur in der Schilddrüse. Damit Zellen Jod aufnehmen können, gibt es Transportproteine, die Natriumiodid-Symporter. Diese sitzen nicht nur in den Zellen der Schilddrüse, sondern auch in verschiedenen anderen Drüsen und Geweben, zum Beispiel in Speicheldrüsen, Magen- und Darmschleimhaut, Brustdrüsen, Prostata, Tränendrüsen und Teilen des Hormonsystems wie Hypophyse und Eierstöcken.
Das bedeutet: Auch diese Gewebe brauchen Jod für ihre Arbeit. Wenn wir immer nur auf die Schilddrüse schauen, unterschätzen wir, wie verteilt Jod im Körper tatsächlich gebraucht wird.
Brustdrüsen, Prostata und Pubertät
Besonders spannend ist die Rolle von Jod in den Brustdrüsen bei Mädchen und Frauen und in der Prostata bei Jungen und Männern.
In der Pubertät verändern sich die hormonaktiven Gewebe stark. Bei Mädchen beginnen die Brustdrüsen zu wachsen, werden hormonell aktiv und beanspruchen mehr Jod. Bei Jungen reifen Hoden und Prostata und verändern sich ebenfalls stark. Das gesamte Hormonsystem fährt hoch, und der Körper braucht in dieser Phase viele Bausteine, zu denen auch Jod gehört.
Wenn die Jodversorgung insgesamt schon eher knapp ist, kann es vorkommen, dass Brustdrüsen und andere Gewebe in dieser Phase vermehrt Jod aufnehmen und für die Schilddrüse vergleichsweise weniger übrig bleibt. Das kann mit dazu beitragen, dass gerade bei Jugendlichen in der Zeit der sexuellen Reife Schilddrüsenfunktionsstörungen sichtbar werden oder sich eine vergrößerte Schilddrüse entwickelt.
Hormone, Fruchtbarkeit und Schwangerschaft
Jod ist über die Schilddrüsenhormone und direkt an der Bildung von Sexualhormonen beteiligt, etwa bei Progesteron und Testosteron. Es spielt damit eine Rolle bei der Regulation des Zyklus, bei der Fruchtbarkeit, bei der Qualität von Eizellen und Spermien und bei Stimmung und Muskelaufbau.
Besonders wichtig ist Jod in der Zeit rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. In dieser Phase muss die Mutter ausreichend versorgt sein und gleichzeitig das Kind mitversorgen. Schon milde Joddefizite in der frühen Schwangerschaft können die Hirnentwicklung des Kindes messbar beeinflussen.
Nervensystem und kindliche Entwicklung
Der sich entwickelnde kindliche Organismus ist auf eine stabile Jodzufuhr angewiesen. Ein ausgeprägter Mangel in der Schwangerschaft und frühen Kindheit kann zu bleibenden Entwicklungsstörungen führen. Auch leichtere Formen von Jodmangel werden mit Einschränkungen von Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit und feiner Motorik in Verbindung gebracht.
Mitochondrien und Energie
Die Mitochondrien, also die „Kraftwerke“ der Zellen, reagieren empfindlich auf die Höhe der Schilddrüsenhormone. Ohne ausreichend Jod kann die Schilddrüse nicht optimal arbeiten. Das Ergebnis kann sich wie ein chronischer Energiemangel anfühlen: ständige Müdigkeit, das Gefühl von innerer Schwere, geringe Belastbarkeit, langsame Regeneration und eine generelle Verlangsamung von Körper und Kopf.
Warum ein langsamer Einstieg sinnvoll ist
Damit Jod überhaupt in die Zellen gelangt, braucht es Transporter wie den Natriumiodid-Symporter. Der Körper reguliert, wie viele dieser Transporter gebildet werden und wie aktiv sie sind. Das hängt unter anderem davon ab, wie viel Jod im System unterwegs ist und welche Signale von Hormonen wie TSH kommen.
Wenn über längere Zeit sehr wenig Jod aufgenommen wird, passt sich der Körper an diesen Mangelzustand an. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen: Er richtet sich in einem sparsamen Modus ein, in dem er mit wenig Nachschub gerade so auskommt. Die Anzahl der Transporter, die Empfindlichkeit der Gewebe und die gesamte Regulation werden auf dieses niedrige Niveau eingestellt.
Beginnt man nach Jahren oder Jahrzehnten plötzlich, hohe Jodmengen zuzuführen, prallt diese Menge auf ein System, das strukturell auf Mangel eingestellt ist. Der Körper kann das nicht von einem Tag auf den anderen verarbeiten, weil Transporter und Zielgewebe erst wieder „hochgefahren“ werden müssen. In dieser Anpassungsphase können Überforderung, Unruhe, Gereiztheit oder Verschlechterungen von Symptomen auftreten, obwohl Jod als Grundidee nötig und sinnvoll ist. Es ist dann nicht „falsch“, sondern einfach zu schnell zu viel.
Genau deshalb ist es sinnvoll, mit Jod langsam einzusteigen, die Reaktion des Körpers zu beobachten und in kleinen Schritten zu steigern. So haben die Natriumiodid-Symporter Zeit, sich neu anzupassen, Drüsen und Gewebe können ihre Speicher geordnet auffüllen und das Zusammenspiel mit anderen Nährstoffen kann Schritt für Schritt stabilisiert werden.
Jod, Oxidationsstress und Schilddrüsenautoimmunität
Bei der Verarbeitung von Jod in der Schilddrüse entstehen vorübergehend reaktive Sauerstoffverbindungen, also freie Radikale. In einem gut versorgten Gewebe werden diese durch Antioxidantien und schützende Nährstoffe neutralisiert. Dazu gehören zum Beispiel Selen, Vitamin A, Vitamin C, Zink und andere antioxidativ wirksame Stoffe.
Fehlen diese Schutzfaktoren und liegt bereits eine Entzündung oder strukturelle Schwächung der Schilddrüse vor, kann eine plötzliche oder sehr starke Erhöhung der Jodzufuhr zusätzlichen Stress erzeugen. Jod ist dann nicht die ursprüngliche Ursache für Hashimoto oder andere Autoimmunprozesse, sondern eher ein Beschleuniger eines bereits instabilen Zustands.
Viele große Untersuchungen betrachten zudem vor allem Jod über jodiertes Speisesalz und nicht über natürliche Lebensmittelquellen oder sorgfältig begleitete Ergänzung. Der Kontext ist also entscheidend: Wie ist die Schilddrüse strukturell aufgestellt, wie sieht der Entzündungsstatus aus, wie sind Selen, Vitamin D, Zink, Omega 3, Darmgesundheit und Stressregulation.
Jodmangel in Deutschland und in typischen Regionen
Deutschland ist geologisch ein klassisches Jodmangelgebiet. Ein großer Teil des Jods ist in früheren Eiszeiten mit Schmelzwässern Richtung Meer ausgewaschen worden. Die Folge: In vielen Binnen- und Gebirgsregionen sind Böden und damit pflanzliche Lebensmittel relativ arm an Jod.
Die Jodversorgung konnte durch Jodsalz und mit Jod angereichertes Tierfutter zeitweise deutlich verbessert werden. In den letzten Jahren zeigen Monitoringprogramme allerdings, dass die Versorgung wieder rückläufig ist. Ein erheblicher Anteil von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen liegt unterhalb der WHO-Grenzwerte für eine als ausreichend bewertete Jodzufuhr.
Besonders betroffen sind eher meeresferne Regionen mit jodarmen Böden, etwa viele südliche Bundesländer und Bergregionen. In Auswertungen wird Baden-Württemberg immer wieder als typisches Jodmangelgebiet genannt, weil hier Böden besonders jodarm sind und gleichzeitig eher weniger Seefisch traditionell verzehrt wird.
Der Trend zu weniger Fleisch und Milchprodukten, seltenerem Fischkonsum, häufiger veganer oder vegetarischer Ernährung ohne bewusste Jodplanung und die gleichzeitige Reduktion von Jodsalz in der Lebensmittelindustrie tragen zusätzlich dazu bei, dass die Versorgung insgesamt wieder nach unten rutscht.
Mögliche Symptome eines Jodmangels
Jodmangel kann sich auf vielerlei Weise äußern. Die folgenden Symptome sind nicht spezifisch, können aber Hinweise geben, dass ein genauer Blick auf Jod, Schilddrüse und Hormonsystem sinnvoll wäre.
Mögliche Anzeichen sind zum Beispiel:
ungeklärte Gewichtszunahme bei gleichbleibender Ernährung
Müdigkeit,
Antriebslosigkeit,
verlangsamtes Denken,
„Brain Fog“, Nebel im Gehirn
Kälteempfindlichkeit, kalte Hände und Füße, schlechtes Warmwerden
trockene, raue, schuppige Haut, rissige Ellenbogen oder Fersen,
Haarausfall
Druck- oder Engegefühl am Hals,
sichtbare Vergrößerung der Schilddrüse
Stimmungsschwankungen bis hin zu depressiven Verstimmungen
Zyklusunregelmäßigkeiten, stärkere Blutungen,
Probleme in der Schwangerschaft
eingeschränkte Fruchtbarkeit bei Frau oder Mann
Wachstums- oder Pubertätsverzögerungen bei Kindern und Jugendlichen
Diese Zeichen ersetzen keine Diagnostik, sie sind aber ein guter Anlass, Schilddrüsenhormone, Struktur der Schilddrüse, Jodstatus und die Versorgung mit anderen relevanten Nährstoffen genauer zu betrachten.
Wie hoch ist der Tagesbedarf
Fachgesellschaften empfehlen je nach Alter unterschiedliche Jodmengen. Für Jugendliche und Erwachsene werden meist etwa 180 bis 200 Mikrogramm pro Tag angegeben, für Säuglinge und Kinder entsprechend weniger, für Schwangere und Stillende etwas mehr.
Diese Werte sind als Mindestzufuhr gedacht, um ausgeprägte Mangelzustände zu verhindern. Wie hoch die persönlich optimale Zufuhr ist, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von Ernährung, Jodgehalt der regionalen Lebensmittel, Darmgesundheit, allgemeinem Nährstoffstatus, Stressbelastung, Hormonlage und davon, ob bereits Schilddrüsenerkrankungen vorliegen.
Wichtig ist, Jod nicht im Alleingang plötzlich hoch zu dosieren, nur weil irgendwo von sehr jodreichen Bevölkerungsgruppen die Rede ist. Ein Organismus, der lange Zeit zu wenig Jod bekommen hat, reagiert anders als einer, der von Anfang an gut versorgt war. Besonders bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, bei Herz-Kreislauf-Problemen, in Schwangerschaft und Stillzeit und im höheren Alter sollten Anpassungen behutsam und begleitet erfolgen.
Jod in Nahrungsergänzungsmitteln
Jod kann über verschiedene Wege ergänzt werden.
Die erste Ebene ist die Ernährung. Wer regelmäßig qualitativ guten Meeresfisch isst, gelegentlich Meeresfrüchte und vorsichtig kleine Mengen Algen nutzt, kann einen großen Teil des Bedarfs decken. Bei vegetarischer oder veganer Ernährung sollten Jodquellen bewusst eingeplant werden, zum Beispiel über gezielt dosierte Algenprodukte mit bekanntem Jodgehalt.
Die zweite Ebene sind moderat dosierte Nahrungsergänzungsmittel. Jod liegt hier meist in Form von Kaliumjodid oder als Algenextrakt wie Kelp vor. Viele gut durchdachte Präparate kombinieren Jod mit anderen wichtigen Nährstoffen wie Selen, Zink, B-Vitaminen, Magnesium und Vitamin D. Damit wird nicht nur Jod ergänzt, sondern auch das Umfeld gestützt, in dem Jod verarbeitet werden muss.
Die dritte Ebene sind höher dosierte Spezialpräparate, zum Beispiel Lugolsche Lösung oder sehr jodreiche Algenkonzentrate. Diese gehören in ein therapeutisches Setting mit erfahrener Begleitung, regelmäßiger Kontrolle von Schilddrüsenhormonen, Entzündungsmarkern, Jodausscheidung und subjektivem Befinden. Für Experimente in Eigenregie sind sie nicht geeignet.
Egal in welcher Form: Die Qualität der Produkte, transparente Angaben zum Jodgehalt, ein langsamer Einstieg und die Einbettung in ein Gesamtkonzept sind entscheidend.
Jodiertes Speisesalz – warum es allein nicht reicht
Jodsalz hat in der Vergangenheit viel zur Verringerung schwerer Mangelfolgen beigetragen. Trotzdem ist es aus mehreren Gründen keine ideale Hauptquelle.
Es basiert meist auf raffiniertem Tafelsalz. Es liefert außer Natrium und Chlorid keine nennenswerten Mineralstoffe.
Oft sind Rieselhilfen zugesetzt, die die Handhabung erleichtern, aber keinen gesundheitlichen Mehrwert haben.
Das zugesetzte Jod ist nicht vollständig stabil. Hitze, Feuchtigkeit, Licht und lange Lagerung können dazu führen, dass ein Teil des Jods im Laufe von Herstellung, Transport, Vorratshaltung und Kochen verloren geht.
Und schließlich steht Jodsalz im Spannungsfeld, dass wir einerseits über Salz Jod zuführen sollen, andererseits aber aus Herz-Kreislauf-Sicht den Salzkonsum begrenzen wollen. Ein Aufbau der Versorgung, der ausschließlich auf Jodsalz als Hauptquelle setzt, ist deshalb aus mehreren Blickwinkeln nicht stimmig.
Empfehlung und Fazit
Jod ist ein kleines Spurenelement mit großer Wirkung. Es spielt eine Rolle für Energie, Stoffwechsel, Hormone, Nervensystem, Fruchtbarkeit, die Entwicklung von Kindern und die Gesundheit vieler Drüsen, darunter Schilddrüse, Brustdrüsen, Prostata, Speicheldrüsen und Hypophyse. In Deutschland ist die Versorgung für viele Menschen eher am unteren Rand oder darunter, vor allem in meeresfernen und gebirgigen Regionen mit jodarmen Böden.
Gleichzeitig ist Jod ein Stoff, bei dem es auf das Wie ankommt. Wichtig sind die begleitenden Schutzfaktoren wie Selen, Vitamin D, Vitamin A, Zink, hochwertige Fette, ein gut funktionierender Darm und ein Stresssystem, das nicht dauerhaft überlastet ist. Genauso wichtig ist die Geschwindigkeit, mit der man etwas verändert. Ein Körper, der lange im Mangelmodus gelebt hat, braucht Zeit, um Transporter, Speicher und Regulation wieder neu auszurichten.
Statt keinerlei Jod zu konsumieren aus Angst, oder umgekehrt sofort hoch zu dosieren, ist ein Mittelweg sinnvoll: bewusste Jodquellen in der Ernährung, ein eventueller sanfter Einstieg mit moderaten Ergänzungen, Beobachtung der eigenen Reaktion und bei Bedarf fachliche Begleitung, vor allem bei bestehenden Schilddrüsenproblemen oder in sensiblen Lebensphasen.
Wenn du dich bei den o.g. Symptomen wiedererkennst, wenn die Schilddrüse bisher nur grob angeschaut wurde oder wenn du das Gefühl hast, dein System läuft dauerhaft knapp über dem Minimum, lohnt sich eine genauere Betrachtung. Ziel ist nicht, eine einzelne Laborzahl zu optimieren, sondern deinem Körper das zurückzugeben, was er braucht, um wieder mehr in seine Kraft, Klarheit und Lebendigkeit zu kommen.
Wenn du solche Infos künftig direkt in dein Postfach bekommen möchtest, trag dich gern in meinen Newsletter ein – dort teile ich regelmäßig praktische Tipps rund um das Thema Mikronährstoffe, funktionelle Medizin, Ernährung und Lifestyle.